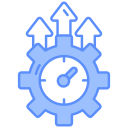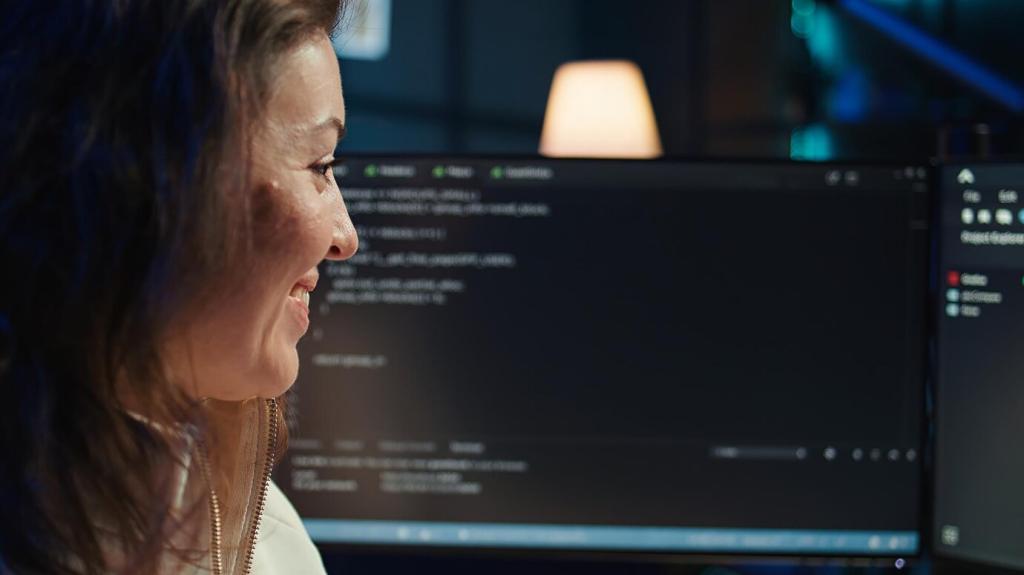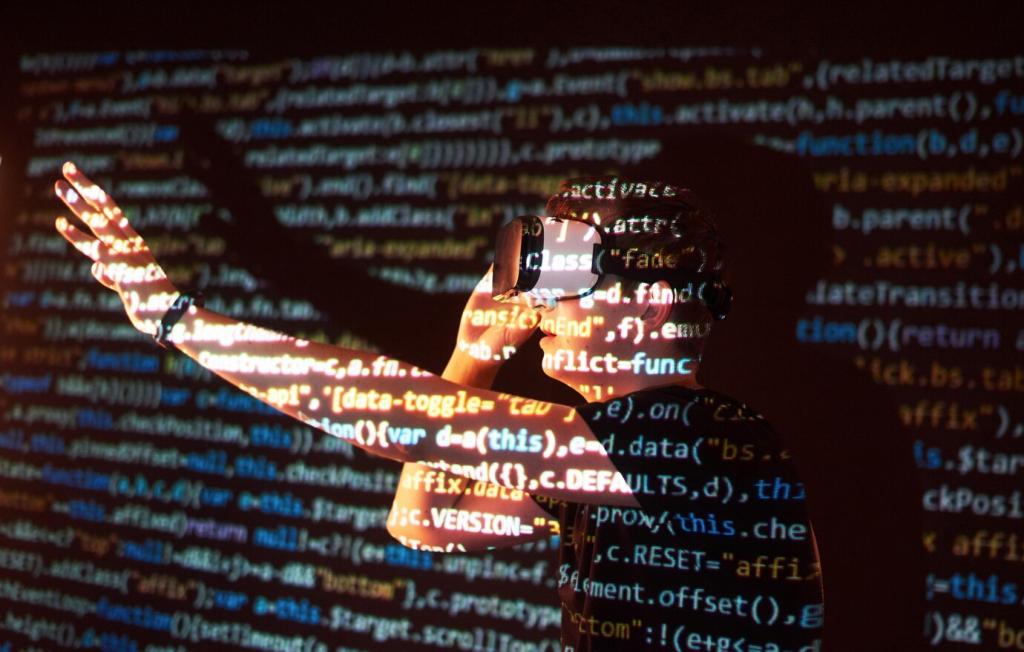UX, Qualität und Wartbarkeit über die Zeit
No‑Code‑Bausteine sichern schnelle Konsistenz; Low‑Code erlaubt eigene Komponenten mit Marken‑Guidelines. Fragen Sie nach unserem Starter‑Set für Designsysteme, um nachhaltige UX zu gewährleisten – unabhängig vom gewählten Ansatz.
UX, Qualität und Wartbarkeit über die Zeit
Low‑Code integriert häufig CI/CD, Testautomatisierung und Environments. No‑Code bietet vereinfachte Veröffentlichungen, teils mit Rollback. Teilen Sie, welche Teststrategie Sie einsetzen und wie Sie Qualität im laufenden Betrieb messen.